VON RICHARD UND ADELHEID OBST
Die heutigen Bürger der Stadt und des Kreises Mettmann verbinden
mit ihrer Kreisstadt hohe Wohnqualität und ein anspruchsvolles Programm
in Sachen Kultur, Sport und soziale Einrichtungen. Der seit der kommunalen
Neugliederung im Jahre 1975 dazugehörige Stadtteil Metzkausen wird
überwiegend als Ort des gehobenen Wohnens und von manchen als kleine
Schlafstadt der Stadt Düsseldorf betrachtet. Der Hinweis, daß
es sich bei dem damaligen Dorf Metzkausen um einen nicht unbedeutenden
Zechenstandort gehandelt hat, wird viele erstaunen. Wir reden dabei nicht
von Kohle, sondern von Blei und Zink.
Nur wenige wissen, wenn sie mit ihrem Fahrzeug die L 156 von Metzkausen
nach Ratingen-Homberg fahren, daß sich kurz nach dem Ortsausgang
auf der linken Straßenseite die ehemalige Blei- und Zinkerzgrube
Benthausen befand. So waren im Haus Nr. 23 die Kantine und die Schlafräume
für bis zu 400 Bergarbeiter untergebracht. Das Haus Nr. 35 bis 37
- vor der Renovierung ein einfacher Ziegelbau - war das ehemalige Beamtenhaus.
Noch heute zeigt das davorliegende Buschgelände deutliche Spuren
der alten Abraumhalde, und wenn man sich genau umsieht, erkennt man noch
das inzwischen zubetonierte Mundloch des Förderschachtes sowie die
Reste seiner Widerlager.
Dem unbefangenen Beobachter drängen sich viele Fragen auf. Warum
ist ein Blei-
und Zinkbergwerk ausgerechnet in Mettmann-Metzkausen errichtet worden?
Wofür brauchte man in früheren Jahren Blei und Zink? Konnte
ein solches Bergwerk überhaupt rentabel betrieben werden? Wer war
damals in der Lage, solch umfangreiche Investitionen zu tätigen?
Das Gebiet der Zeche Benthausen ist ein im äußersten Südwesten
liegender Ausläufer des „Velberter Sattels". Der südliche
Teil besteht überwiegend aus Schichten des unteren und oberen Devons
sowie des oberen Mitteldevons. In den Erdformationen des Devons vermutete
man zunächst keine abbauwürdigen Blei-, Kupfer-, Zinn- und Zinkadern.
Sie durchziehen aber an bestimmten Bruchstellen auch die devonischen Schichten.
Die Zeche Benthausen ist nicht die einzige Blei- und Zinkerzgrube gewesen.
Im Osten und Nordosten gab es zum Beispiel auch die Zechen Fortuna, Emanuel,
Josefine, Fernande und Wilhelm II. Diese Zechen lagen allerdings auf dem
Gebiet der heutigen Städte Wülfrath und Velbert. Verschiedentlich
wurde schon im 16. Jahrhundert in den vorgenannten Zechen nach Blei und
Zink geschürft.
Man hatte zunächst auf den Feldern des Gutes Benthausen in Metzkausen
Blei und Zink gefunden. Bereits in einer Beschreibung aus dem Jahre 1740
wurde auf dieses Blei- und Zinkerzvorkommen hingewiesen. Am 12. Dezember
1752 wurde dem Freiherrn vor Syberg auf Aprath, dem damaligen Besitzer
des Gutes Bent-
hausen, für einen Stoller "Erbstollengerechtigkeit" gegeben und
derselbe „mit sechs nächsten Maaßen" belehnt. Wegen
der hohen Investitionskosten und der damit verbundenen Risiken kam es
zu keinem systematischen Abbau. Die Vorkommen wurden landesweit kaum abgebaut,
da der Landesherr den „Zehnten" verlangte und keiner sonderliches
Interesse hatte, etwas zu riskieren, wenn er nicht selbst den Erfolg haben
oder den Handel betreiben konnte.
Die Zeche Benthausen, über die hier berichtet wird, hatte keine lange,
dafür aber eine sehr bewegte Geschichte. 1885 entdeckten die Gebrüder
Römer das Erzvorkommen erneut. Sie ließen Untersuchungen anstellen
und tatsächlich ergaben die Bohrungen erhebliche Bleivorkommen. 1886
wurden dem königlichen Oberbergamt in Dortmund die ersten Mutungen
des Erzvorkommens handschriftlich eingereicht. Einige Zeit später
am 30. August 1889 wurde unter genauer Angabe der Grubenfelder die Genehmigung
zum Abbau des Erzes „Im Namen des Königs"
durch das Oberbergamt erteilt. Weitere Untersuchungen ergaben, daß
tiefergelegene Schichten eine Mächtigkeit zwischen 7 und 30 cm hatten
und somit das Erzvorkommen abbauwürdig war. Damit waren die Grundvoraussetzungen
für den umfangreichen Ausbau eines Blei- und Zinkerzbergwerks gegeben.
Zunächst wurde ein Schacht von 74 Metern abgeteuft. Von dort aus
wurden mehrere Querschläge und Stollen in verschiedene Richtungen
vorangetrieben. Die Zeche wurde laut Urkunde des Oberbergamtes von 1892
auf neun Grubenfelder erweitert. Ein weiterer Schacht von 131 Metern Tiefe
wurde notwendig. Im Endausbau hatte das Erzbergwerk außer diesen
beiden Schächten weitere 10 Luftschächte, ein Stollenmundloch
im Weyermannsbusch, sowie in der 44 Meter tiefen Sohle 4500 bis 5000 Meter
Strecke, in der 74 Meter tiefen Sohle 1500 Meter Strecke und in der 131
Meter tiefen Sohle 2000 Meter Strecke.

Von der Eisenbahn in Köln wurden eine Halle in einer Größe
von 15 x 25 m und ein Dampfkessel gekauft. Der Transport dieser Großgüter
von Düsseldorf nach Metzkausen bereitete für damalige Verhältnisse
extreme Probleme. Für den Transport des Kessels von Düsseldorf
nach Metzkausen waren bis zum alten Gallberg 28 Kaltblutpferde erforderlich.
Dabei handelte es sich um eine relativ ebene mit nur einer mäßigen
Steigung versehenen Strecke. Vom Gallberg bis zum Zechengelände waren
dann sogar 54 Pferde notwendig. Für heutige Verhältnisse ist
es fast unvorstellbar, welch ein technischer Aufwand erforderlich war,
um bis zu 54 Kaltblutpferde gleichzeitig einzuspannen.
Der Kessel und die Lokomotivhalle wurden auf dem damaligen Zechengelände
aufgebaut. Das erste Zechengebäude war allerdings die Bleiwäsche.
Es folgten die Häuser für die beiden Fördermaschinen, eine
Schmiede und Schlosserei, die Schreinerei und ein zweistöckiger Pferdestall
für zwölf Pferde sowie ein Beamtenhaus, in dem vier Familien
wohnten.
Zur damaligen Zeit gab es auch in Metzkausen schon elektrischen Strom,
mit dem das Licht für den Betrieb erzeugt wurde. Um das Wasser aus
den Stollen und Schächten zu pumpen, waren leistungsfähige Maschinen
erforderlich, die nur mit Starkstrom betrieben werden konnten. Auch den
gab es damals schon. Dabei handelte es sich allerdings um eine Seltenheit.
Aber selbst den Luxus einer Telefonanlage von Metzkausen nach Mettmann
leisteten sich die damaligen Grubeneigentümer, die Herren Römer.
Nach den Erstinvestitionen erforderten die bisher beschriebenen umfangreichen
Erweiterungen der Stollenanlagen und Gebäude naturgemäß
einen sehr hohen Investitionsaufwand. Selbst sehr reiche Leute dürften
Schwierigkeiten gehabt haben, ein solches Blei- und Zinkbergwerk von den
Investitions- bis zu den Betriebskosten zu finanzieren. Seinerzeit gab
es eine heute kaum mehr bekannte, aber sehr moderne Möglichkeit der
Finanzierung einer solchen Erzgrube.
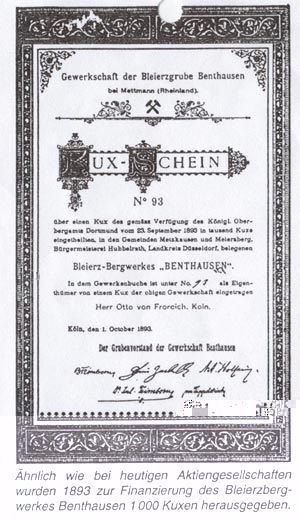 |
Wie heute große Firmen, die als Aktiengesellschaften organisiert sind, Aktien herausgeben, wurden damals - wie die Urkunden belegen - 1000 Kuxen unter notarieller Aufsicht ausgegeben. Kuxen sind auf den Namen lautende Wertpapiere, die auf einen bestimmten Anteil (1/100stel, 1/1000stel, 1/10000stel usw.) an einer bergrechtlichen Gewerkschaft lauten. In ihrer Handhabung ähneln sie vinkulierten Namensaktien, das heißt, eine Übertragung der Kuxen durch Übertragungsvermerk auf der Rückseite war relativ leicht möglich, erforderte aber die Zustimmung der bergrechtlichen Gewerkschaft als Emittentin oder Herausgeberin der Kuxe. |
Heute dürfen bergrechtlichen Gewerkschaften nicht mehr gegründet
werden. Sie wurden nach neuerem Recht von den Aktiengesellschaften verdrängt.
Wenn man von Gewerkschaften spricht, denkt man automatisch an politisch
orientierte Vereinigungen von Arbeitnehmervertretern. Das gilt nicht für
bergrechtliche Gewerkschaften. Diese waren eine Kapitalgesellschaft des
Bergrechts ohne festes Grundkapital und im weitesten Sinne mit Aktiengesellschaften
vergleichbar. Die Gewerken, das waren die Eigentümer der Kuxen oder
auch Gesellschafter, nahmen am Gewinn und Verlust entsprechend dem Verhältnis
ihrer Kuxe - das war in Benthausen mindestens 10000stel - teil. Einzelne
reiche Personen erwarben von den hier ausgegebenen Kuxen sogar bis zu
94 Stück. Die Erwerber kamen aus ganz Deutschland und zum Teil sogar
aus dem Ausland. So waren etwa der Freiherr von Baden-Baden, die Herren
von Tippelskirch und Schlieper und mehrere Fabrikanten, Gutsbesitzer und
Rentner aus Wiesbaden, Straßburg, München usw. Eigentümer
von Kuxen. Diese Personen waren natürlich an einer möglichst
großen Rendite interessiert. Die Hoffnungen bestätigten sich
auch zunächst. Als 1891 der Erzabbau begann, erzielte man einen schon
damals höchst
beachtlichen monatlichen Überschuß von ca. 12000 Mark.
Wegen seiner Reinheit fand das Bleierz sowohl als Treiberz bei der Silbergewinnung
als auch in der Emailindustrie als Glasurerz umfangreiche Verwendung.
In der Hauptsache wurde es allerdings für Leitungsrohre und zur Munitionsherstellung
gebraucht.
Mit der Erzförderung und dem damit verbundenen Betrieb der Zeche
entwickelte sich auch für die Geschäfts- und Wirtsleute in Metzkausen
und Mettmann eine Blütezeit, denn der Bedarf von bis zu 400 Arbeitern
auf der Zeche mußte befriedigt werden. Es waren aber nicht nur die
Arbeiter, sondern auch ihre Familien, die sich hier ansiedelten. Junge
ledige Arbeiter aus der Eifel und dem Westerwald wurden hier ansässig
und gründeten Familien.
Zwischenzeitlich ersetzte die Armee die Bleigeschosse durch Stahlgeschosse
und in der Industrie wurden weitgehend Stahlrohre statt der Bleirohre
produziert. Damit kam es für die Zeche Benthausen zwangsläufig
zu einer schicksalshaften Wende, die in weiten Teilen mit der aktuellen
Entwicklung des Kohlebergbaus im Ruhrgebiet vergleichbar ist. Leider war
der Kaiser zur damaligen Zeit nicht bereit, die


Zeche Benthausen zu subventionieren, um dort Arbeitsplätze zu erhalten.
1895 standen daher nur noch 149 Personen auf der Lohnliste der Schachtanlage.
Der Preisverfall auf dem Londoner Metallmarkt um die Jahrhundertwende
wirkte sich auch auf Benthausen aus. Da das Erz aus dem Ausland billiger
eingeführt werden konnte als es auf der Zeche Benthausen gefördert
wurde, war das Ende des Zechenbetriebs absehbar. Nachdem die Schachtanlagen
immer unrentabler arbeiteten und rote Zahlen geschrieben wurden, kam es
1904 trotz des damals guten Zustands der Grube und der Abbaumöglichkeiten
von mehr als 1500 Tonnen Bleierz zu einer endgültigen Stillegung
der Zeche Benthausen. Damit starb ein für die Region bedeutsamer
Wirtschaftsbetrieb in aller Stille.
Ob sich der Erwerb der Kuxen als Wertpapiere finanziell gelohnt hat, erscheint
in Anbetracht der Höhe der Investitionen und Betriebskosten trotz
der anfänglich sehr hohen Gewinne höchst zweifelhaft. Die
Gebäude wurden verl t oder abgerissen. Fritz Wehrmeister erwarb damals
für 3200 Mark den größten Teil der Betriebsgebäude.
Für das Zechengebäude wurden lediglich 8000 Mark gezahlt. Hierbei
muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß der Eigentümer
auch die Schachtanlagen auf dem Gelände mit erworben hat, die er
beseitigen lassen mußte. Trotz der nicht unerheblichen Strecken-
und Stollenvortriebe auf den verschiedenen Sohlen mit einer Länge
von insgesamt ca. 8500 Metern ist es nie zu Problemen wie zum Beispiel
Tagesbrüchen in diesem Bereich gekommen.
Es hat sogar ernsthafte Überlegungen gegeben, die Zeche Benthausen
im Jahre 1913 zu revitalisieren. Aus einem Gutachten des Bergassessors
Arnold aus Düsseldorf vom 15. November 1913 geht hervor, daß
dann, wenn ihm Mittel zur Verfügung gestellt würden, er sich
für die Wiederaufnahme des Zechenbetriebes Benthausen einsetzen würde,
weil nach seiner Überzeugung die Zeche bei geeigneter Betriebsleitung
und Verwaltung zu einem gewinnbringenden Betrieb geführt werden könnte.
Leider ist diese Idee nicht aufgegriffen worden. Dabei hätten sich
die daraus resultierenden zusätzlichen industriellen Impulse auf
die weitere Entwicklung der Region möglicherweise durchaus positiv
auswirken können.
Wer weiß, ob nicht früher oder später die Bodenschätze
unterhalb des Zechengeländes für den bergischen Raum noch einmal
bedeutsam werden können. Auf absehbare Zeit jedoch wird die Zeche
Benthausen im heutigen Mettmann-Metzkausen wohl nur Geschichte bleiben.
